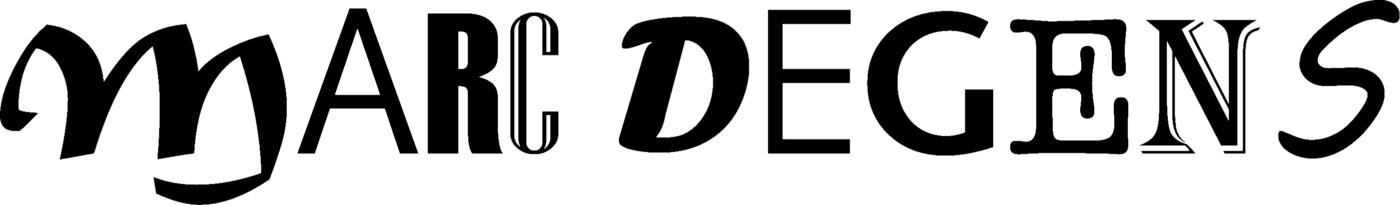Eriwan. Aufzeichnungen aus Armenien. Kapitel 5
Die geröstete Nuss




In Berlin absolvierte ich zudem auf den letzten Drücker einen Erste-Hilfe-Kurs und stellte einen Antrag auf Ersterteilung eines PKW-Führerscheins. Zwar konnte man in Armenien für fünfhundert Dollar einen Führerschein kaufen, doch dieser wurde in Deutschland nicht anerkannt. Da ich zudem den für den Führerschein notwendigen Sehtest nicht bestanden hatte, musste ich mir in einer Blitzaktion auf dem ersten Kilometer unserer Radtour nach Kopenhagen in aller Eile eine Brille aussuchen und anfertigen lassen. Aufgrund eines Missverständnisses im Brillengeschäft hatte ich mich leider für das falsche der beiden in die engere Auswahl gekommenen Modelle entschieden. Das war wirklich bedauerlich, denn mit der anderen Brille sah ich aus wie Durs Grünbein und das hätte mein literarisches Schaffen bestimmt beflügelt.
Der Besuch des türkischen Präsidenten Gül in Eriwan sorgte in Armenien für eine hoffnungsvolle Stimmung und war selbst der deutschen Tagesschau Sendezeit wert gewesen. Die Präsidenten stellten die Einsetzung einer gemeinsamen Historikerkommission zur Erforschung des Genozids in Aussicht und sogar über eine mögliche Öffnung der türkisch-armenischen Grenze wurde diskutiert. Im Herbst initiierten türkische Intellektuelle anlässlich des Jahrestages der Ermordung von Hrant Dink eine Unterschriftenaktion, mit der sie sich bei den Armeniern für das erlittene Unrecht des Jahres 1915 entschuldigten. Diese Unterschriftenaktion wurde allerdings sowohl von der türkischen Regierung als auch von nationalistischen Armeniern, vor allem in der amerikanischen Diaspora, kritisiert. Der türkischen Regierung ging die Erklärung zu weit, während die Armenier gegen das Fehlen des Wortes »Genozid« protestierten. Auch beim späteren Besuch von US-Präsident Obama in der Türkei wurde ebenfalls genauestens darauf geachtet, ob er das »G«-Wort benutzen würde oder nicht. Obama tat es nicht. Angesichts der äußersten Empfindlichkeit beider Nationen in dieser Frage blickte ich der zukünftigen Entwicklung leider eher skeptisch entgegen.
Nur wenig hatte ich von den Olympischen Sommerspielen in Peking mitbekommen, bei der die Armenier im Medaillenspiegel mit immerhin sechs Bronzemedaillen – einmal Boxen, zweimal Ringen, dreimal Gewichtheben – den respektablen neunundsiebzigsten Rang belegten und zeitweise angeblich die höchste Pro-Kopf-Medaillensammlung aufwiesen. Zum vierten Mal hatte Armenien an den Olympischen Sommerspielen teilgenommen und diesmal fünfundzwanzig Sportler, dreiundzwanzig Männer und zwei Frauen, in sieben verschiedenen Individual-Sportarten nach China entsandt. Es war ein Beleg für die These von Gagik, der behauptete, dass Armenier zwar gute Einzel-, aber keine guten Mannschaftssportler seien.










Etwas später suchten wir noch einen Facharzt im Republikanischen Krankenhaus auf, ein zusehends verfallender Betonblock im Norden der Stadt. Zum fünften Stock, in dem der Spezialist praktizierte, fuhr Alexandra in einem ehemaligen Bettenfahrstuhl, in dem es sich die Fahrstuhlführerin wohnlich eingerichtet hatte. In dem Aufzug standen ein Sessel und ein Garderobenständer, für Behaglichkeit sorgten außerdem ein Teppich und Landschaftsgemälde an den Fahrstuhlwänden. Vor der Sprechstunde rauchte der Professor seine Zigarette zwar zu Ende, dafür lief während Alexandras Untersuchung die ganze Zeit der Fernseher, der in der Ecke stand und eine Verkaufssendung für Gebrauchtwagen zeigte, die der Professor durch die Augenwinkel verfolgte.
Der Herbst war für Alexandra dicht gefüllt mit offiziellen Universitätsbesuchen und zahlreichen Gesprächsrunden und Konferenzen. Hervorzuheben war die internationale »Dissemination Conference on Internal Quality Assurance« an der Staatlichen Universität. Obwohl ein großer Teil der Teilnehmer aus England und Italien stammte, gab es keine Übersetzung der armenischen Vorträge, statt dessen wurden Anglistik-Studentinnen dazu verpflichtet, den Ausländern die Übersetzung über die Schulter ins Ohr zu flüstern. Leider waren die Studentinnen nicht auf das Thema vorbereitet worden und konnten daher nicht einmal den Titel der Konferenz übersetzen. Auch die aus dem Unterricht gerufenen und nach neunzig Minuten eintreffenden Englisch-Dozentinnen konnten nicht viel helfen. Erst nach über vier Stunden trafen echte Dolmetscher ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alexandra bereits beschlossen, auf die Erkenntnisse dieser Tagung zu verzichten.
Ein weiterer Termin führte sie an die Russisch-Armenische Universität. Sie nahm ein Taxi, doch der Fahrer fand den Weg nicht und irrte zwanzig Minuten lang orientierungslos durch die Stadt. Als Alexandra beschloss, das Taxi zu wechseln, ausstieg und in einem anderen Taxi die Fahrt fortsetzte, verfolgte der erste Taxifahrer wütend den Wagen, blockierte mit seinem Taxi die Einfahrt der Universität und verlangte lautstark, aber letztlich vergebens sein Geld.




Mit einem alten DDR-Reiseführer in der Hand spazierten wir durch Eriwan, erfuhren viel über die Monumentaldenkmäler, und waren erstaunt, wie wenig sich seither verändert hatte. Auf Einladung von Ani besichtigten wir das Opernhaus und sahen uns zusammen ein Konzert anlässlich des Programmstarts des neuen armenischen TV-Kultursenders »Ararat«. Ein großes achtzigköpfiges Orchester mit über vierzig Geigen und Bratschen und hochkarätigen armenischen Solisten spielte Stücke von Tschaikowski, Verdi und natürlich auch des armenischen Starkomponisten Chatschaturjan, dessen bekanntestes Werk der Säbeltanz aus dem Ballett »Gajane« war.
Der Staatsminister hatte zu Beginn des Konzerts eine Ansprache gehalten und zwischen den Stücken erläuterte ein Moderatorenpaar die Schwerpunkte des Kultursenders und zählte die kommenden Sendungen auf. Das Konzertprogramm dauerte über zwei Stunden, es gab keine Pause, etliche TV-Kameras waren anwesend, der Saal hell erleuchtet und das Publikum laut. Später beim Zappen stießen wir immer wieder auf den Sender, der entweder klassische Konzerte oder Fußballspiele zeigte. Leider waren alle Fußballspiele mit deutscher Beteiligung, die ich in dieser Zeit sah, grauenhaft, ganz besonders die Heimniederlage meiner Borussia aus Dortmund gegen Udinese Calcio. Die Bandenreklame »bet & win« übersetzte ich in dieser Zeit nur noch mit »bete und weine«. Dafür schaffte ich selber das schier Unmögliche und ergatterte bei Super Mario Galaxy alle einhundertzwanzig Sterne und schaltete damit Luigi frei. Der Kampf gegen den Zauberer beim lila Kometen kostete mich eine volle Batterieladung, noch krasser war allerdings der Marsch durch das sich auflösende Spielfeld in der Spielzeugschachtel-Galaxy. Nur wenige Menschen in meinem Alter konnten wahrscheinlich von sich behaupten, diese Aufgabe gemeistert zu haben.
Wie schon ein Jahr zuvor, diesmal allerdings eher zufällig, besuchten wir den Wohltätigkeitsbasar im Marriott-Hotel. Beim Stand der Deutschen Botschaft entschuldigten wir uns dafür, keinen Kuchen gespendet zu haben und erleichterten unser schlechtes Gewissen durch den Kauf von mehreren Gebäckstücken. Lange, leider erfolglos, durchforsteten wir daraufhin das Zeitschriften- und DVD-Angebot der amerikanischen Botschaft und wie schon im letzten Jahr wusste keiner, wofür die Einnahmen des Basars eigentlich gespendet wurden.
Zum Mittagessen suchte ich nun öfter die Mensa der nah gelegenen Amerikanischen Universität auf. Das Essen war günstig und die Ausgabe erfolgte in der Regel zügig. Die Mensa hatte den Flair einer polnischen Milchbar und bot frische armenische Gerichte an. In der Mensa gab es zudem einen von mir geschätzten Kakao-Automaten und ich war enorm erleichtert, nicht mehr in das Restaurant an der U-Bahnstation »Druschba« gehen zu müssen. Beim letzten Mal hatte ich dort nach endlosem Warten einen »Cheeseburger« bekommen, ein halbiertes Brötchen mit zerschmolzenem Fett – ohne Bulette.
Anfang Oktober besuchte ich das erste armenische Comicfestival in einem kleinen Theater in der Nähe vom Matenadaran, das von der französischen Botschaft mitveranstaltet wurde. Es bestand aus einem Workshop und einer Ausstellung von in einheitlicher Größe fotokopierten und gerahmten Comicseiten. Spektakulär waren die sieben aus Frankreich eingeladenen Comiczeichner, darunter Frank Margerin und der armenischstämmige Charles Berbérian, dessen »Monsieur Jean«-Bände Teil meiner Eriwaner Basisbibliothek waren. Organisiert wurde das Festival vom ebenfalls armenischstämmigen Franzosen Jean Mardikan, einem der drei Mitbegründer des legendären Comicfestivals in Angoulême.

Langsam zog der Winter in der Stadt ein. Wir ließen das Ofenrohr reinigen und bekamen Ende Oktober Besuch von unserem Freund Markus und seinem Schweizer Kollegen. Im Nebel war ihr Taxi gegen eine Felswand gefahren, das Auto war dabei umgekippt und auf dem Dach gelandet. Zum Glück war ihnen bis auf einen Kratzer an Markus‘ Hand nichts weiter passiert. Wir kochten Gulasch und unterhielten uns lange über Berg-Karabach, die Mentalität der Armenier, das Leben im Ausland, die WOZ und die Jugendproteste in Zürich Anfang der 80er Jahre, die der Schweizer Kollege aus nächster Nähe miterlebt hatte. Zum Abschied lieh sich Markus von mir das Buch »Zürich, Anfang September« von Reto Hänny aus, ein von mir sehr geschätztes Werk.
Regelmäßig besuchte ich den Goethe-Lesesaal und inspizierte die Neuanschaffungen. In der Auslage entdeckte ich die Autobiographie »Ich. Erfolg kommt von innen« von Oliver Kahn und staunte. Noch erstaunter war ich allerdings, als mir zwei Tage später auf dem Mesrop Maschtoz Boulevard ein junges Mädchen entgegen kam – mit der Biographie des Torwarttitans unterm Arm.
Im November nutzten wir die Mitfahrgelegenheit und fuhren mit Bianca und armenischen Deutschlehrerinnen für ein Wochenende nach Tbilissi. Im Bus erzählte eine Deutschlehrerin, dass sie in Eriwan auf der Straße kürzlich einen Mann getroffen habe, der ein T-Shirt trug, auf dem auf deutsch stand: »Ich bin super im Bett«. Sie fragte den Mann, ob er wüsste, was da auf deutsch auf seinem T-Shirt stehe. Er habe nur den Kopf geschüttelt.
Ich las derweil in den »Aufzeichnungen aus Georgien« von Clemens Eich: »Die schlechtesten Straßen von allen schlechten Straßen Georgiens befinden sich in Gurien.« Nach der Ankunft am Goethe-Institut fuhren wir mit einem überteuerten Taxi zum Hotel »GTM Kapan«, in dem wir ein Zimmer über ein Internetportal gebucht hatten. Die Internetbeschreibung versprach ein großes, komfortables Zimmer, das Hotel sollte über Schwimmbad, Sauna und WLAN verfügen, als »Special« lockten ein Begrüßungsgetränk und ein kostenloses Upgrade in die nächst höhere Zimmerkategorie. Unsere Erwartungen waren dementsprechend hoch, es war Winter und wir sehnten uns nach ein wenig Erholung, um so enttäuschter waren wir, als man uns das Doppelzimmer präsentierte. Es befand sich im finsteren Kellergeschoss, war in einem düsteren Dunkelgrün gestrichen, an den Wänden standen übereck zwei Einzelbetten, dazu gab es einen riesigen, brummenden Kühlschrank und eine winzige Duschkabine. Sogleich kehrten wir an die Rezeption zurück und verlangten ein echtes Doppelzimmer. Der Hotelangestellte erklärte uns, dass das Hotel ausgebucht sei und nur noch zwei weitere Zimmer frei wären, eines davon sei aber aus der »Lux«-Kategorie, so dass wir dafür einen Aufschlag von dreißig Euro pro Tag hätten zahlen müssen.

Wir besichtigten die Ersatzzimmer, wobei uns das »Lux«-Zimmer noch deprimierender und außerdem recht laut vorkam, und siedelten schließlich in ein Standard-Eckzimmer mit Ikea-Bett um. Die Badezimmermatte schwamm in Wasser, da das Waschbecken leckte, an dem Bett waren zwei Klemmlampen befestigt, die beide nicht funktionierten und der versprochene Internetzugang war ein durchgetrenntes Ethernetkabel. Der Name des Hotels hatte sich also als böses Omen erwiesen, da das Hotel in Kapan, in dem wir auf der Deutschmobil-Tour untergekommen waren, die schlechteste Unterkunft war, in der wir jemals übernachtet hatten. Abgesehen vom Zimmer war der Ausflug nach Tbilissi aber schön und gemütlich, wir besuchten Alexandras Kollegen und seine Familie und fühlten uns am anderen Tag beim Abendessen im Restaurant »Purpur« wie in Berlin.
Höhepunkt des Novembers waren die Deutschen Kulturtage in Eriwan. Die von der Deutschen Botschaft und dem DAAD veranstalteten Kulturveranstaltungen wurden sogar mit einem Werbeclip im armenischen Fernsehen beworben, so dass mein Gesicht und Ausschnitte aus dem »Kettengassenpan«-Video von Superschiff nun schlagartig vielen Armeniern bekannt waren.